Wenn ein Bauträger ein Grundstück von einer Kommune kaufen will, denkt er oft: Vergaberecht - das ist doch nur für große Bauprojekte mit öffentlichen Aufträgen, oder? Falsch. Seit Mai 2024 ist die Rechtslage klar - aber auch gefährlich, wenn man sie falsch versteht. Viele Projekte sind noch immer blockiert, weil Bauträger und Kommunen nicht wissen, wann genau das Vergaberecht greift. Und wer das nicht checkt, riskiert nicht nur Geld, sondern den ganzen Vertrag.
Reiner Grundstücksverkauf? Dann gilt das Vergaberecht nicht
Der einfachste Fall: Die Kommune verkauft ein unbebautes Grundstück an einen Bauträger. Keine Baupflicht, keine Erschließung, kein Mietvertrag, kein Bauvorhaben - nur der Boden. Dann: kein Vergaberecht. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 15. Mai 2024 endgültig bestätigt. Das war eine Wende. Zwei Jahre lang hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf (Ahlhorn-Urteil) gesagt: Nein, auch bei Bebauungsverpflichtungen muss ausgeschrieben werden. Das hat Hunderte Projekte lahmgelegt. Jetzt weiß man: Das war falsch. Ein Grundstücksverkauf bleibt ein Fiskalgeschäft - egal, ob der Käufer später ein Haus baut. Die Kommune hat kein Recht, den Bau zu steuern, wenn sie nicht ausgeschrieben hat.
Wann wird’s gefährlich? Wenn Bauarbeiten dazu gehören
Jetzt kommt der Punkt, der viele Bauträger umbringt: Wenn die Kommune im Kaufvertrag schreibt, der Erwerber muss ein Gebäude errichten, das bestimmte Vorgaben erfüllt - etwa 50 Sozialwohnungen mit bestimmten Standards - und das Bauvolumen über 5,15 Millionen Euro liegt, dann ist das kein Grundstücksverkauf mehr. Dann ist es ein Bauauftrag. Und das unterliegt dem Vergaberecht. Das ist kein theoretisches Detail. Das ist der Unterschied zwischen einem sicheren Projekt und einem, das nach zwei Jahren vor Gericht landet.
Ein Beispiel: Eine Stadt verkauft ein Grundstück für 3 Millionen Euro. Dazu verpflichtet sie den Käufer, ein Mehrfamilienhaus mit 60 Wohnungen zu bauen - Kosten geschätzt 7 Millionen Euro. Gesamtinvestition: 10 Millionen. Aber: Der Bauanteil liegt über 5,15 Millionen. Also: Ausschreibungspflicht. Wer das nicht einhält, riskiert, dass der Vertrag für nichtig erklärt wird. Der Bauträger hat sein Geld investiert - und dann: nichts. Kein Grundstück, kein Bau, kein Gewinn.
Die Trennung ist entscheidend: Kaufpreis vs. Baukosten
Ein typischer Fehler: Kommunen packen alles in einen Preis. Sie sagen: „Das Grundstück inklusive Baupflicht kostet 10 Millionen.“ Keine Aufschlüsselung. Keine klare Trennung. Das ist ein roter Faden für Nachprüfungsverfahren. Die Kanzlei Görg sagt es klar: „Trennen Sie Kaufpreis und Baukosten. Schreiben Sie es explizit in den Vertrag.“
Warum? Weil das Vergaberecht nur bei Bauaufträgen greift - nicht bei Grundstücken. Wenn der Kaufpreis 3 Millionen und die Baukosten 7 Millionen betragen, dann ist der Bauauftrag ausschreibungspflichtig. Wenn der Kaufpreis 8 Millionen ist und die Baukosten nur 2 Millionen, dann ist es ein Grundstücksverkauf mit Nebenverpflichtung - kein Vergaberecht. Die Aufschlüsselung ist Ihr Schutzschild.
Was ist mit Wohnungsbaugesellschaften?
Fast jede Kommune hat eine eigene Wohnungsbaugesellschaft. Und die? Die sind meist öffentliche Auftraggeber - auch wenn sie wirtschaftlich agieren. Das hat das OLG Rostock im März 2024 bestätigt. Warum? Weil ihre Hauptaufgabe sozialer Wohnungsbau ist. Gewinne sind Nebensache. Wenn die Gesellschaft also eine Seriensanierung von 15 Häusern plant und der Auftrag über 5,15 Millionen Euro liegt, dann muss sie ausschreiben. Auch wenn sie selbst die Tochter der Stadt ist. Viele haben das bisher ignoriert. Das ändert sich jetzt. Wer mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft arbeitet, muss prüfen: Ist das ein öffentlicher Auftrag? Wenn ja - Ausschreibung.

Was passiert, wenn man’s falsch macht?
Die Konsequenzen sind schwerwiegend. Ein Nachprüfungsverfahren kann Monate dauern. Der Bauträger hat bereits Bodenplatte, Baugenehmigung, Finanzierung - alles auf dem Tisch. Dann kommt die Klage: „Sie haben nicht ausgeschrieben.“ Der Vertrag wird aufgehoben. Der Bauträger verliert sein Projekt. Die Kommune verliert den Investor. Und die Stadt? Sie hat ein leeres Grundstück und keine Lösung.
Ein Fall aus Düsseldorf: Ein Bauträger hat 2022 ein Projekt gewonnen - mit einer Bebauungsverpflichtung. Die Stadt dachte: „Kein Problem, es ist nur ein Grundstücksverkauf.“ Der Wettbewerb wurde nicht ausgeschrieben. Ein Konkurrent klagte. Nach 14 Monaten Rechtsstreit wurde der Vertrag für nichtig erklärt. Der Bauträger verlor 1,8 Millionen Euro Entwicklungskosten. Er hat heute kein Projekt mehr. Und die Stadt? Sie hat immer noch kein Wohnhaus auf dem Grundstück.
Was ändert sich ab 2025 in Nordrhein-Westfalen?
Ein weiterer Punkt: NRW will ab 2025 die komplizierten kommunalen Vergabegrundsätze abschaffen. Statt detaillierter Regeln gibt es nur noch: „Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Gleichbehandlung.“ Das klingt gut - ist aber riskant. Warum? Weil es keine klaren Verfahren mehr gibt. Bauträger können nicht mehr sicher sagen, ob ein Verfahren korrekt war. Die Kommunen bekommen mehr Spielraum - aber auch mehr Haftungsrisiko. Wer mit NRW-Kommunen arbeitet, muss noch vorsichtiger sein. Die alten Regeln waren kompliziert - aber klar. Die neuen sind einfach - aber unklar.
Was tun, wenn Sie als Bauträger ein Projekt planen?
Prüfen Sie diese drei Fragen - vor jedem Angebot:
- Steht im Vertrag, dass der Erwerber etwas bauen muss? Wenn ja: Wie hoch sind die Baukosten? Ist der Wert über 5,15 Millionen Euro?
- Wurde der Kaufpreis klar von den Baukosten getrennt? Wenn nein: Fordern Sie eine Aufschlüsselung an. Schreiben Sie sie in den Vertrag.
- Arbeiten Sie mit einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft? Dann prüfen Sie: Ist das ein öffentlicher Auftrag? Wenn ja: Ausschreibung nötig.
Wenn Sie unsicher sind - holen Sie einen Rechtsanwalt mit Vergaberecht-Spezialisierung dazu. Nicht nach dem Vertrag. Nicht nach dem Angebot. Vorher. Die Kosten für eine kurze Prüfung sind lächerlich im Vergleich zu einem verlorenen Projekt.

Warum ist das jetzt besser als vor 2024?
Die Ahlhorn-Rechtsprechung hat die deutsche Städtebaupraxis fast zum Erliegen gebracht. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund schätzt, dass 1,2 Milliarden Euro an Investitionen blockiert wurden. Bauträger haben Projekte abgelehnt, weil sie keine Sicherheit hatten. Kommunen haben Grundstücke nicht mehr verkauft - aus Angst vor Klagen.
Jetzt ist das vorbei. Der EuGH hat klargestellt: Reiner Grundstücksverkauf = kein Vergaberecht. Das ist eine enorme Erleichterung. Kommunen können wieder schneller bauen. Bauträger können wieder sicher Angebote abgeben. Die Zahlen sprechen für sich: 87 % der Kommunen bewerten die neue Rechtslage als „erleichternd“. Das ist kein kleiner Erfolg. Das ist ein Paradigmenwechsel.
Der einzige Nachteil: Wer jetzt noch denkt, „wir machen es wie vor 2021“, läuft Gefahr, sich zu verhaken. Die Rechtslage ist klar - aber nur, wenn man sie versteht. Und das müssen Bauträger jetzt tun. Nicht nur, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist. Sondern weil es um ihre Existenz geht.
Die größte Falle: Der versteckte Bauauftrag
Die gefährlichste Form ist der versteckte Bauauftrag. Die Kommune sagt: „Wir verkaufen das Grundstück, aber wir erwarten, dass Sie ein Gebäude bauen, das unseren städtebaulichen Zielen entspricht.“ Keine konkreten Baupläne. Keine Kostenangaben. Nur: „Machen Sie es gut.“
Das ist ein juristischer Zeitbombe. Warum? Weil der EuGH sagt: Wenn die Kommune die Bauausführung steuert - auch nur indirekt - und der Wert über der Schwellen liegt, dann ist es ein Bauauftrag. Und der muss ausgeschrieben werden. Prof. Dr. Christiane Wendehorst von der Universität Potsdam warnt: „Kommunen versuchen oft, Bauleistungen in den Grundstückspreis einzupreisen, um Ausschreibungen zu umgehen. Das ist rechtlich riskant - und wird immer öfter angefochten.“
Wenn Sie als Bauträger so einen Vertrag bekommen: Fordern Sie Klarheit. Wenn die Kommune nicht genau sagt, was gebaut werden muss und wie viel es kostet, dann ist das kein sicheres Angebot. Dann ist das ein Risiko. Und Risiken sollten Sie nicht eingehen - nicht in einem Markt, der schon schwer genug ist.
Was kommt als Nächstes?
Die Rechtslage ist jetzt stabil - aber nicht endgültig. Die Bundesregierung prüft, ob das Vergaberecht für kleine kommunale Projekte weiter vereinfacht werden kann. Auch die Digitalisierung der Ausschreibungsverfahren wird vorangetrieben. Aber das ändert nichts an der Grundregel: Reiner Grundstücksverkauf = kein Vergaberecht. Bauauftrag über 5,15 Mio. Euro = Ausschreibungspflicht.
Was Bauträger jetzt brauchen, ist Klarheit - und Mut, sie einzufordern. Wer sich auf die neue Rechtslage einstellt, kann wieder planen. Wer sich auf alte Irrtümer verlässt, wird wieder scheitern.
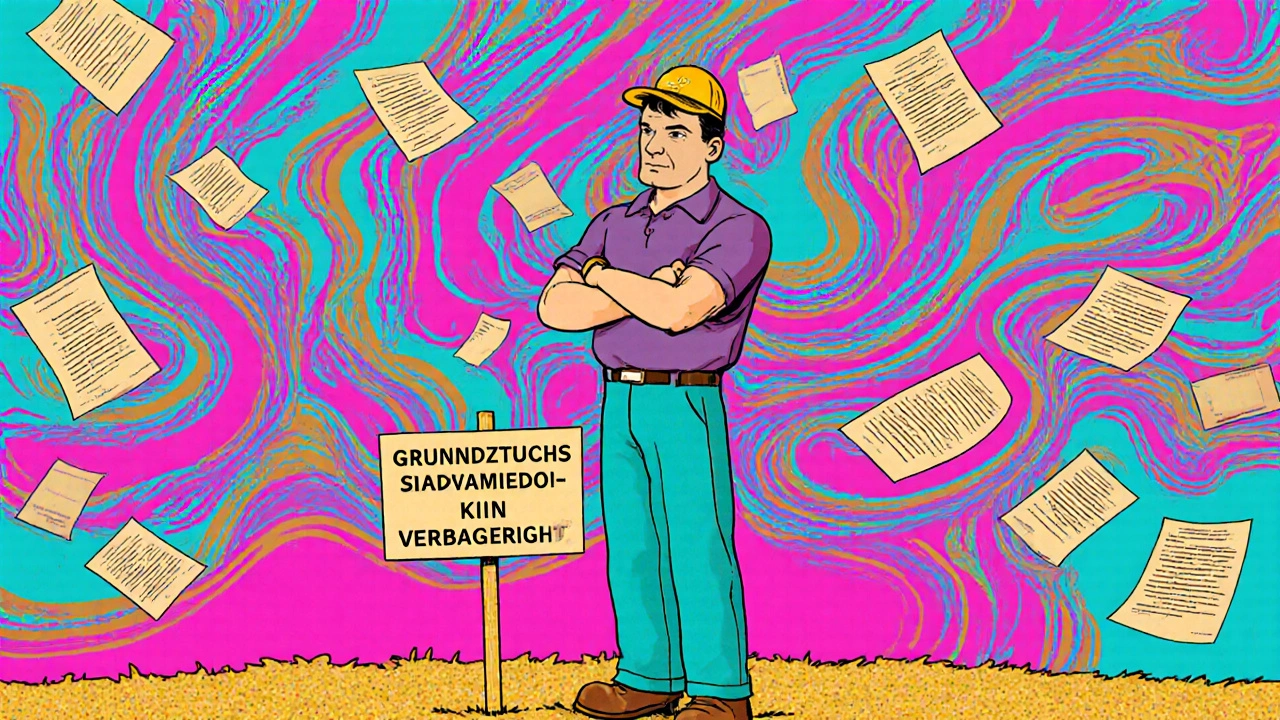

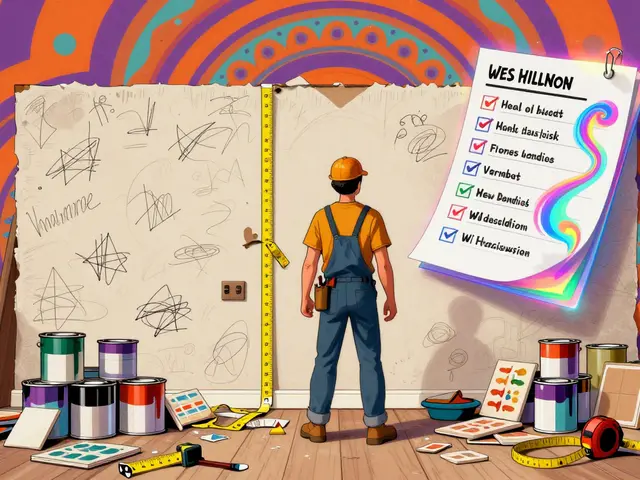

Kommentare
Julia Nguyen November 17, 2025
Endlich mal jemand, der die Wahrheit sagt! Diese ganzen Bauträger, die denken, sie können mit 'Machen Sie es gut' umgehen - nein, das ist keine Bauplanung, das ist juristischer Blödsinn! Der EuGH hat klargestellt: Wer Bauvorgaben macht, muss ausschreiben. Punkt. Und Kommunen, die das immer noch ignorieren, sollten sich mal eine Strafzahlung holen. Ich hab selbst ein Projekt verloren, weil die Stadt 'städtebauliche Ziele' als Ausrede benutzt hat. Kein Wunder, dass die Leute wegziehen. Jetzt endlich klare Regeln - aber nur, wenn man sie durchsetzt. 🤬
Eduard Parera Martínez November 17, 2025
Sag mal, wer liest sowas überhaupt? Ich hab den Text nur überflogen. Aber wenn ich das richtig verstanden hab, dann muss man halt schreiben was man will. Und wenn nicht, dann nicht. Fertig.
Daniel Shulman November 19, 2025
Die Trennung von Kaufpreis und Baukosten ist tatsächlich der kritische Hebel - und das ist kein juristischer Feinheiten-Spiel, das ist ein riskantes Compliance-Defizit. Viele Kommunen operieren noch im 'Vertragsrausch'-Modus, wo alles in einen Topf geworfen wird, um den Eindruck zu erwecken, es sei ein 'fiskalisches Transaktionsereignis'. Aber nach der EuGH-Rechtsprechung und der OLG-Rostock-Entscheidung ist das ein klassischer Fall von 'concealed public procurement'. Die Schwellenwertregelung von 5,15 Mio. Euro ist nicht willkürlich - sie entspricht der EU-Vergaberichtlinie 2014/24/EU, Abschnitt 2.3. Wer hier nicht differenziert, läuft Gefahr, dass der gesamte Vertrag nach § 125 BGB anfechtbar wird. Und das ist kein theoretisches Szenario: Ich hab vor drei Monaten einen Fall bearbeitet, wo ein Bauträger 2,3 Mio. € in Planung investiert hat, und dann kam die Nachprüfung wegen unklarer Aufschlüsselung. Alles weg. Also: Trennen. Dokumentieren. Anwalt einschalten. Vorher. Nicht nachher. Das ist nicht nur rechtlich klug - das ist betriebswirtschaftlich überlebenswichtig.