Warum ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus so schwierig ist
Ein Balkon, der nachträglich an ein Mehrfamilienhaus angebaut wird, klingt wie eine einfache Lösung: mehr Platz, mehr Licht, mehr Lebensqualität. Doch wer glaubt, dass man einfach ein paar Stahlträger an die Fassade schweißt und schon kann man Kaffee trinken, liegt falsch. In Deutschland ist ein solcher Anbau kein Heimwerkerprojekt - er ist ein komplexes, rechtlich und technisch hochgradig reguliertes Vorhaben. Und das gilt besonders für Mehrfamilienhäuser, wo nicht nur die Bauordnung, sondern auch das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) entscheidet.
Im Jahr 2023 wurden bundesweit über 12.750 Balkonanbauten an Mehrfamilienhäusern genehmigt - ein Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr. Doch hinter jeder dieser Genehmigungen steckt ein Prozess, der Monate dauert, Hunderte von Euro kostet und oft die Geduld der ganzen Eigentümergemeinschaft auf die Probe stellt. Der größte Fehler? Denken, man könnte es sich sparen, die Regeln einzuhalten. Denn ungenehmigte Balkone führen in 78 % der Fälle zu Nachbesserungen - und in 32 % der Fälle sogar zum Abriss.
Genehmigung: Wer sagt Ja, wer sagt Nein?
Ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus ist kein privater Anbau. Er verändert die Fassade, beeinflusst die Statik des gesamten Gebäudes und kann den Nachbarn Licht, Luft oder Ruhe nehmen. Deshalb braucht er eine Baugenehmigung - und das in jedem Bundesland, ohne Ausnahme. Selbst kleine Balkone unter 6 m², die in Ein- oder Zweifamilienhäusern manchmal verfahrensfrei sind, sind bei Mehrfamilienhäusern immer genehmigungspflichtig.
Doch die Baugenehmigung ist nur die halbe Miete. Die wichtigere Entscheidung kommt von den anderen Eigentümern. Nach der WEG-Reform von 2020 reicht für einen Balkonanbau eine einfache Mehrheit gemäß § 25 WEG. Das bedeutet: Wer mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen hat, kann bauen. Klingt einfach? Ist es aber nicht. Denn wer sich gegen den Anbau wehrt, kann nicht einfach „Nein“ sagen - er muss begründen, warum er unbillig benachteiligt wird. Das ist laut § 20 Abs. 4 WEG der einzige rechtlich zulässige Grund.
Praktisch heißt das: Ein Nachbar, der Angst vor Lärm oder Schatten hat, muss konkret nachweisen, wie der Balkon ihn beeinträchtigt. Ein bloßes „Ich mag das nicht“ reicht nicht. Aber: Wer einen Balkon direkt vor seinem Fenster plant, muss mit Widerstand rechnen. In Berlin dauerte es sieben Monate, bis eine 12-Parteien-Gemeinschaft sich einigte. In München wurde ein Antrag abgelehnt, weil der Balkon die Sicht auf den Innenhof verschloss - und das war ein gültiger Einwand.
Statik: Was die Tragfähigkeit wirklich bedeutet
Ein Balkon ist kein Tisch, auf dem man eine Tasse Kaffee abstellt. Er muss Lasten aushalten, die bis zu 300 Kilogramm pro Quadratmeter betragen - das entspricht 3,0 kN/m² nach DIN 1055. Das ist die Mindestanforderung. Aber es gibt noch mehr: Schnee, Wind, Menschen, Pflanzen, Gartenmöbel. Und das alles muss der Balkon tragen, ohne das Gebäude zu belasten.
Die statische Berechnung ist der entscheidende Punkt, an dem 65 % aller Bauanträge scheitern. Viele Architekten und Bauunternehmen unterschätzen das. Sie liefern eine grobe Schätzung, aber die Bauaufsichtsbehörde verlangt einen detaillierten Nachweis nach DIN EN 1991-1-3. Dazu gehören mindestens drei Lastfälle: Eigenlast (das Gewicht des Balkons selbst), Nutzlast (Menschen und Möbel) und Schneelast. Und die Schneelast ist nicht überall gleich. In Niedersachsen sind es 0,65 kN/m², in Bayern bis zu 1,25 kN/m². Wer das nicht berücksichtigt, bekommt die Genehmigung nicht - wie in München, wo ein Balkon nachträglich abgerissen werden musste, weil die Schneelastzone nicht eingerechnet war.
Auch die Verbindung zwischen Balkon und Gebäude ist kritisch. Eine unsachgemäße Anbindung kann Wärmebrücken erzeugen - und das führt nicht nur zu Energieverlusten (bis zu 15 % mehr Heizkosten), sondern auch zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade. Das ist kein kleiner Fehler. Das ist ein teurer Fehler. Und der wird oft erst Jahre später sichtbar - wenn die Putzschichten abplatzen oder die Decke im Wohnzimmer schimmelt.

Kosten: Was wirklich draufkommt
Die Kosten für einen Balkon an einem Mehrfamilienhaus liegen zwischen 8.000 und 25.000 Euro pro Balkon. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die eigentlichen Kosten beginnen viel früher.
- Architektenleistung: 1.500 - 2.500 Euro (für Planung, Bauantrag, Statik)
- Statisches Gutachten: 800 - 1.500 Euro (abhängig von Komplexität)
- Baugenehmigungsgebühr: 500 - 2.000 Euro (je nach Kommune und Bauvolumen)
- Bauausführung: 6.000 - 22.000 Euro (je nach Material: Stahlbeton, Edelstahl, Holz, Glas)
- Wartung und Dichtungen: 300 - 800 Euro pro Jahr (für Dichtheitsprüfung, Reinigung, Reparaturen)
Edelstahl mit Glasgeländer kostet bis zu 24.500 Euro - das ist der Premiumpreis. Stahlbeton mit Holzgeländer liegt bei 10.000 bis 14.000 Euro. Und wer denkt, er spart, indem er einen billigen Anbieter nimmt, irrt. Die 12 negativen Bewertungen von Balkonbauer.de auf Trustpilot (Stand September 2024) beziehen sich fast ausschließlich auf versteckte Kosten, schlechte Beratung und verzögerte Genehmigungen.
Ein weiterer Faktor: Förderung. In Berlin gibt es bis zu 5.000 Euro pro Balkon über das Programm „Mehr Leben im Viertel“. In anderen Bundesländern gibt es keine direkten Zuschüsse - aber manche Kommunen senken die Gebühren für energetisch sinnvolle Anbauten. Wer sich nicht informiert, lässt Geld liegen.
Die 7-Schritte-Checkliste für Ihren Balkonanbau
Ein Balkonanbau ist kein spontaner Entschluss. Er braucht Planung, Geduld und Durchhaltevermögen. Hier ist der praktische Weg, den erfolgreiche Eigentümergemeinschaften gehen:
- Vorabklärung beim Bauamt: Fragen Sie, ob Ihr Haus grundsätzlich für Balkonanbauten geeignet ist. Fragt man nicht, läuft man Gefahr, später alles abreißen zu müssen.
- Machbarkeitsstudie durch Architekten: Lassen Sie prüfen, ob die Fassade tragfähig ist, ob die Abstände zu Nachbarn passen und ob die Schneelastzone passt.
- WEG-Beschlussfassung: Einberufen Sie eine Eigentümerversammlung. Bringen Sie klare Pläne, Kostenübersichten und rechtliche Hinweise mit. Je besser informiert, desto weniger Widerstand.
- Statisches Gutachten erstellen: Dieses Dokument ist das Herzstück Ihres Antrags. Lassen Sie es von einem zertifizierten Ingenieur erstellen - nicht vom Bauunternehmer.
- Bauantrag stellen: Unterlagen: Grundriss, Ansichten, Statikgutachten, Einverständniserklärung der Eigentümer, Lageplan. Digital einreichen, wo möglich - in Baden-Württemberg geht das seit Juli 2024 über „bau.digital-bw.de“.
- Genehmigung abwarten: Der Prozess dauert 4 bis 12 Wochen - in Hamburg war es einmal 14 Monate, wegen widersprüchlicher Vorgaben. Haben Sie Geduld, aber dokumentieren Sie jeden Schritt.
- Bauausführung: Nur mit genehmigtem Plan bauen. Keine Abweichungen. Keine „kleinen Änderungen“. Die Bauaufsicht kommt - und wenn sie etwas anderes findet, ist der Balkon weg.
Der durchschnittliche Zeitraum von der ersten Idee bis zur Fertigstellung: 10 bis 14 Monate. Wer das nicht weiß, ist bald frustriert.

Was Sie unbedingt vermeiden müssen
Es gibt drei Fehler, die fast jeder macht - und die fast immer teuer enden:
- Fehler 1: Keine WEG-Beschlussfassung. Wer ohne Mehrheit baut, riskiert nicht nur eine Abmahnung - er riskiert einen Abrissbefehl. Und der ist nicht nur teuer, er ist demütigend.
- Fehler 2: Kein statischer Nachweis. Die meisten Bauunternehmen bieten „Balkonsets“ an - fertige Elemente, die man an die Wand hängt. Aber ohne Berechnung für Ihr spezifisches Haus ist das eine Zeitbombe. 65 % der Ablehnungen kommen genau daher.
- Fehler 3: Die Nachbarn ignorieren. Ein Balkon, der Schatten auf die Terrasse wirft oder Lärm in die Wohnung bringt, wird nicht nur abgelehnt - er wird juristisch bekämpft. Ein guter Anwalt für Bau- und Wohnungseigentumsrecht ist in diesem Fall kein Luxus, sondern eine Versicherung.
Was kommt als Nächstes? Trends und Ausblick 2025
Der Balkonanbau ist kein Trend - er ist eine Notwendigkeit. In Städten wie München, Berlin oder Köln wird Wohnraum knapper. Balkone sind die billigste Form der Wohnraumerweiterung. Deshalb wächst der Markt: Der BDIA prognostiziert ein jährliches Wachstum von 12 bis 15 % bis 2030.
Aber es ändert sich auch die Regelung. Seit 2024 ist Baden-Württemberg Vorreiter mit dem digitalen Bauantrag. Bis 2026 will die Bundesregierung eine einheitliche digitale Bauakte einführen - das wird die Genehmigungsprozesse vereinfachen. Aber gleichzeitig verschärfen einige Bundesländer die Regeln: Bayern hat den Mindestabstand zu Nachbargrundstücken von 1,50 auf 2,00 Meter erhöht - um Lärm zu reduzieren.
Und dann gibt es noch die Denkmalschutz-Hürde: In historischen Vierteln werden nur 28 % der Balkonanträge genehmigt. Wer in einem Altbau mit Fassadenschutz wohnt, muss sich auf einen langen Kampf einstellen - oder auf einen anderen Plan setzen.
Was bleibt? Ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus ist kein Luxus - er ist eine Investition. In Wohnqualität, in Wertsteigerung, in Lebensfreude. Aber nur, wenn man ihn richtig macht. Wer die Regeln kennt, die Kosten einkalkuliert und die Gemeinschaft mit einbezieht, wird belohnt. Wer sie ignoriert, zahlt den Preis - oft mit dem Balkon, der nicht mehr da ist.
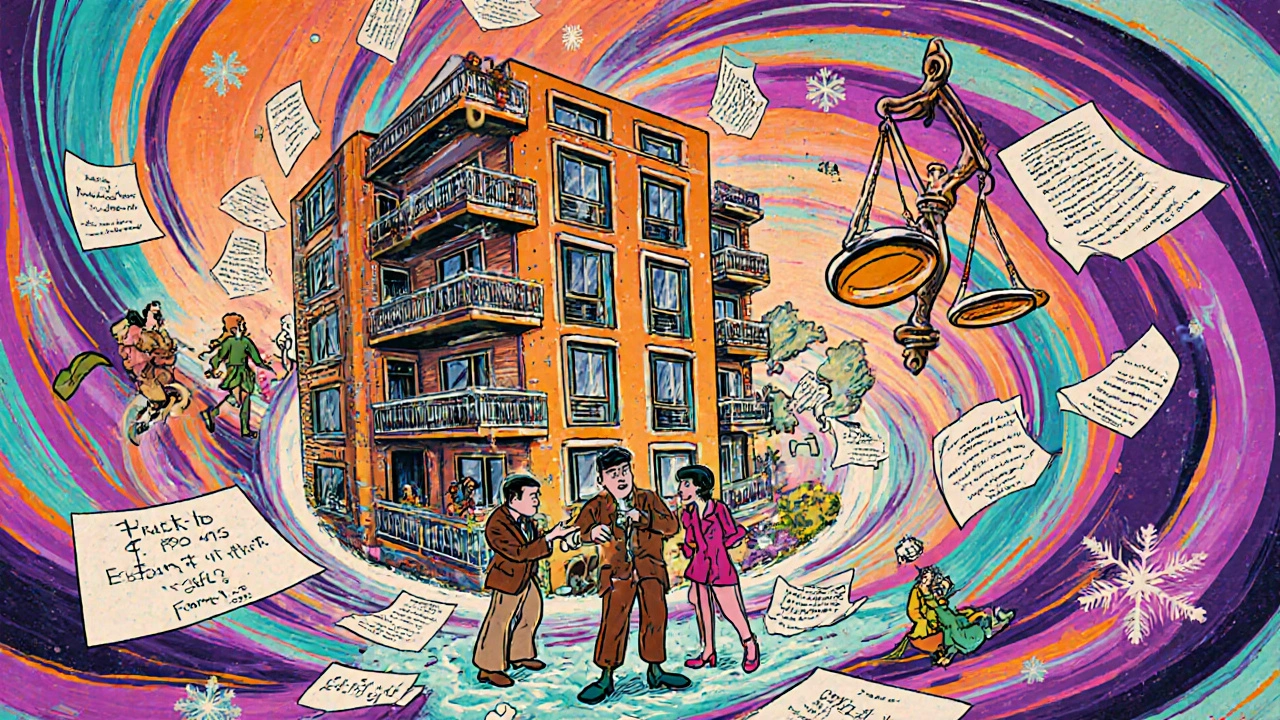



Kommentare
Stephan Viaene Oktober 30, 2025
Interessant, dass die Schneelast in Bayern so viel höher ist als in Niedersachsen. Hab das nie bedacht, dass das regional so unterschiedlich ist. Ich dachte, das ist bundesweit einheitlich.
Lea Relja Oktober 30, 2025
Oh mein Gott, wieder so ein Text, der uns alle zum Weinen bringt!! Wer hat denn das erfunden?? Dass man jetzt 14 Monate warten muss, nur weil jemand einen Balkon will?? Und dann noch so ein Gezeter mit Statik und WEG und Gutachten?? Ich hab doch nur ein paar Pflanzen und einen Stuhl, warum muss das so kompliziert sein??!! Es ist doch nur ein Balkon!!
Kristin Borden November 1, 2025
Ich verstehe, dass es stressig ist, aber wirklich, das ist eine gute Anleitung. Wer sich die Zeit nimmt, alles richtig zu machen, spart später viel Ärger. Ich hab vor zwei Jahren einen Balkon gebaut, und es hat 11 Monate gedauert – aber wir haben alles genehmigt, und jetzt hat keiner Probleme. Keine Nachbesserung, kein Schimmel, kein Stress. Es lohnt sich, langsam zu machen.
Patrick Sargent November 1, 2025
Und wer bezahlt das alles? Die Mieter? Die Eigentümer? Die Steuerzahler? Irgendwer muss das bezahlen. Ich wette, die Kommunen kassieren die Gebühren und dann ist alles wieder teurer. Und die ganzen Digitalisierungspläne? Das ist nur ein neuer Weg, uns noch mehr zu belasten. Ich sag’s ja immer: Die Bürokratie frisst sich durch die Wände.
Nicole Bauer November 2, 2025
Ich find’s gut, dass du die 7-Schritte-Checkliste mit aufgenommen hast. Vielen Leuten fehlt einfach der Überblick. Ich hab vor einem Jahr mit meiner WG angefangen, einen Balkon zu bauen – und haben gleich den Architekten eingeschaltet. Hatte auch Angst, dass die anderen dagegen sind. Aber mit klaren Plänen und einem offenen Gespräch war es gar nicht so schwer. Wichtig ist: Nicht warten, bis es jemand anders macht. Und nicht denken, man kann was sparen, indem man’s selbst macht. Statik ist kein DIY-Projekt. Und die Nachbarn nicht ignorieren – die sind später deine besten Verbündeten, wenn alles läuft.