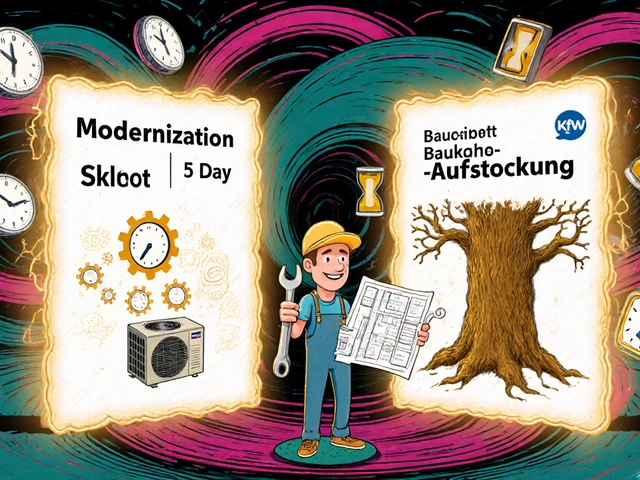Wenn du deine Immobilie sanierst, ist die Fassadendämmung eine der wirkungsvollsten Maßnahmen. Sie senkt die Heizkosten, verbessert das Wohnklima und schont die Umwelt. Aber welches Material ist wirklich das richtige für dein Haus? EPS, Mineralwolle, PUR oder doch lieber Holzfaser? Die Wahl entscheidet nicht nur über die Kosten, sondern auch über die Lebensdauer deiner Fassade und sogar über den Brandschutz. In diesem Vergleich erfährst du, was wirklich zählt - basierend auf aktuellen Daten, Expertenmeinungen und echten Erfahrungen aus dem Feld.
Warum Fassadendämmung heute Pflicht ist
Seit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 1. November 2020 gilt für fast alle Gebäude in Deutschland eine Mindestanforderung an die Wärmedämmung. Wer sanieren will, kommt nicht mehr um eine fachgerechte Fassadendämmung herum. Das ist kein Trend, sondern eine gesetzliche Vorgabe. Und es hat einen klaren Grund: Gebäude verbrauchen in Deutschland mehr als 30 % des gesamten Energiebedarfs. Die Hälfte davon geht allein für die Heizung drauf.
Eine gut gedämmte Fassade kann den Heizenergiebedarf um 20 bis 30 % senken. Das bedeutet für eine durchschnittliche Familie: bis zu 3,5 Tonnen CO₂ weniger pro Jahr. Das ist so viel, als würdest du 15.000 km mit dem Auto fahren - und das jedes Jahr. Die Bundesregierung will bis 2030 12 Millionen Gebäude sanieren. Das ist kein Traum, sondern eine Notwendigkeit, um die Klimaziele zu erreichen.
Doch nicht jede Dämmung ist gleich. Die Materialwahl beeinflusst nicht nur die Energiebilanz, sondern auch die Feuchtigkeit in der Wand, den Brandschutz und sogar den Wert deiner Immobilie. Und das ist der Punkt, an dem viele scheitern: Sie wählen das billigste Material - und landen mit Problemen, die teurer sind als eine gute Lösung von Anfang an.
EPS: Der Marktführer - billig, aber riskant?
Fast 60 % aller Fassadendämmungen in Deutschland werden mit EPS (expandiertes Polystyrol), auch bekannt als Styropor, ausgeführt. Warum? Weil es günstig ist. Die Materialkosten liegen bei nur 13 bis 20 Euro pro Quadratmeter für eine 14 cm starke Dämmung. Die Verarbeitung ist einfach, die Gewichtsbelastung gering, und die meisten Handwerker haben damit Erfahrung.
Doch hier kommt der Haken: EPS hat eine Wärmeleitfähigkeit von 0,032 bis 0,040 W/(m·K). Das ist nicht schlecht - aber auch nicht hervorragend. Um den gleichen Dämmwert wie mit PUR zu erreichen, brauchst du 4 bis 6 cm mehr Dicke. Das bedeutet mehr Material, mehr Gewicht und mehr Platz an der Fassade.
Und dann ist da noch die Feuchtigkeit. EPS ist diffusionssperrend. Das heißt: Wasser kann nicht durch das Material entweichen. Bei Altbauten mit alten Mauerwerken, die noch atmen, führt das zu Tauwasserschäden. Der Feuchtigkeitsüberschuss bleibt in der Wand - und das kann zu Schimmel, Putzverlust oder sogar Zerstörung des Mauerwerks führen. Ein Nutzer auf bauforum24.de berichtet: „Habe 2022 EPS mit 14 cm an meinem EFH von 1985 dämmen lassen. Heizkosten sanken um 28 %. Aber im Winter 2022/23 hatte ich Feuchtigkeit im Erdgeschoss.“
Die Verbraucherzentrale hat 2022 142 Beschwerden zu Fassadendämmungen registriert. 29 % davon betrafen die falsche Materialwahl für Altbauten. EPS ist kein schlechtes Material - aber es ist nicht für jedes Haus geeignet. Für Neubauten mit dichten Wänden? Perfekt. Für ein Haus aus den 1950er Jahren? Ein Risiko.
Mineralwolle: Die sichere Wahl für Altbauten
Wenn du ein älteres Haus hast - besonders wenn es aus Ziegel, Kalkstein oder Lehm besteht - dann ist Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle) die bessere Wahl. Sie hat dieselbe Wärmeleitfähigkeit wie EPS, also 0,032-0,040 W/(m·K), aber einen entscheidenden Vorteil: Sie ist diffusionsoffen. Feuchtigkeit kann durch das Material wandern und an der Außenluft abgeführt werden. Das verhindert Tauwasser und Schimmel in der Wand.
Und dann ist da der Brandschutz. Mineralwolle ist nicht brennbar - Klasse A1. Das ist der höchste Wert. Bei einem Brand bleibt das Material stabil, es gibt keine giftigen Gase, und es trägt nicht zur Brandausbreitung bei. Das ist besonders wichtig für Gebäude über 7 Meter Höhe, denn ab 2025 schreibt die EU-Neuregelung 2023/811 genau das vor: Nicht brennbare Dämmstoffe.
Ein weiterer Pluspunkt: Schallschutz. Mineralwolle dämmt nicht nur Wärme, sondern auch Lärm. Das merkst du besonders, wenn du neben einer Straße oder in einer dicht bebauten Gegend wohnst.
Der Nachteil? Der Preis. Mit 38 bis 45 Euro pro Quadratmeter ist Mineralwolle 80-100 % teurer als EPS. Und die Verarbeitung ist aufwändiger. Sie ist staubig, erfordert Schutzkleidung, und die Dämmplatten müssen exakt zugeschnitten werden. Aber: Die Nutzerbewertungen auf hellweg.de sind überwiegend positiv. 4,5 von 5 Sternen bei 63 Bewertungen - mit vielen Kommentaren wie: „Kein Schimmel mehr, und die Wände fühlen sich einfach gesünder an.“
Prof. Dr. Martin Krus vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik sagt klar: „Bei Altbauten ist diffusionsoffene Dämmung kein Luxus - sie ist eine Notwendigkeit.“
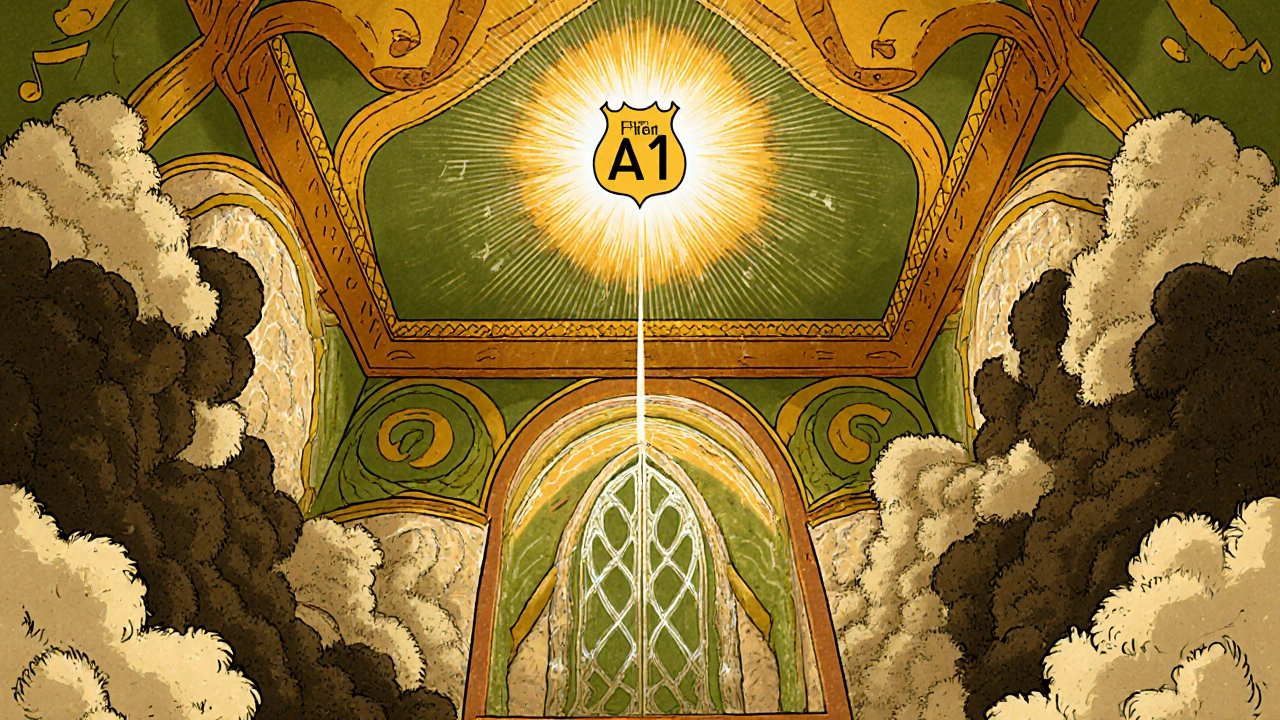
PUR und PIR: Hochleistung für enge Flächen
Wenn du wenig Platz hast - etwa bei einem Haus mit engen Vorgärten oder einem denkmalgeschützten Gebäude, bei dem die Fassade nicht stark verändert werden darf - dann ist PUR (Polyurethan) oder PIR (Polyisocyanurat) die Lösung. Beide haben die beste Wärmeleitfähigkeit aller gängigen Dämmstoffe: 0,022-0,027 W/(m·K). Das bedeutet: Mit nur 10 cm Dicke erreichst du denselben Dämmwert wie mit 14-16 cm EPS oder Mineralwolle.
Das ist ein großer Vorteil. Du sparst nicht nur Platz, sondern auch Gewicht. Und du veränderst das Aussehen deiner Fassade weniger. Für Sanierungen in historischen Quartieren ist das oft entscheidend.
Doch es gibt einen Haken: PUR ist teuer. Mit 45 bis 55 Euro pro Quadratmeter kostet es fast dreimal so viel wie EPS. Und es ist empfindlich. UV-Licht zersetzt es. Deshalb muss es sofort nach der Verlegung mit Putz oder einer Beschichtung abgedeckt werden. Bei unsachgemäßer Verarbeitung kann es sich verformen oder Blasen werfen.
PIR ist eine Weiterentwicklung von PUR - stabiler, aber noch teurer. Mit 106 Euro pro Quadratmeter bei 19 cm Dicke ist es das teuerste Material hier. Es lohnt sich nur, wenn du wirklich auf jede Zentimeter Dicke achten musst - und die Kosten nicht zählen.
Naturdämmstoffe: Die Zukunft, die schon heute möglich ist
Immer mehr Hausbesitzer fragen: Gibt es eine Alternative, die nicht aus Erdöl kommt? Die Antwort ist ja: Naturdämmstoffe wie Holzfaser, Kork, Hanf oder Stroh.
Holzfaserplatten haben eine Wärmeleitfähigkeit von 0,038-0,045 W/(m·K). Sie sind diffusionsoffen, regulieren die Luftfeuchtigkeit im Raum und binden CO₂ während ihrer Herstellung. Ein Nutzer mit einem denkmalgeschützten Haus aus 1890 berichtet: „Wir haben Holzfaser mit 16 cm verbaut. Keine Feuchtigkeitsprobleme. Die Kosten lagen bei 48 €/m² - aber wir haben keine Angst mehr vor Schimmel.“
Kork ist ähnlich - wasserabweisend, atmungsaktiv und sehr langlebig. Beide Materialien sind 30-50 % teurer als EPS, aber sie haben einen Vorteil, den kein synthetischer Stoff hat: Sie sind biologisch abbaubar und werden in Zukunft immer wichtiger.
Die Bundesregierung fördert sie jetzt sogar stärker. Ab 2024 gibt es beim BAFA-Förderprogramm „Altersgerecht Sanieren“ bis zu 25 % Zuschuss - max. 15.000 Euro. Und die Prognose ist klar: Bis 2027 soll der Anteil von Naturdämmstoffen von 3 % auf 12 % steigen. Die EU will den Einsatz von Erdöl-basierten Dämmstoffen bis 2030 reduzieren. Die Zukunft ist bio.
Was kostet die Fassadendämmung wirklich?
Die Materialkosten sind nur ein Teil der Wahrheit. Die Gesamtkosten für ein Einfamilienhaus mit 150 m² Fassadenfläche liegen je nach Material zwischen 3.000 und 7.500 Euro bei EPS, bei Mineralwolle zwischen 5.700 und 6.750 Euro. Die Differenz kommt nicht nur vom Material - sondern von der Verarbeitung. Mineralwolle braucht mehr Zeit, mehr Schutz, mehr Präzision. Das kostet Arbeitsstunden.
Ein Fachbetrieb braucht für eine komplette Fassadendämmung 25 bis 30 Tage. Wer das selbst macht, unterschätzt die Komplexität. Die Handwerkskammer Berlin sagt: „Für Heimwerker braucht man mindestens 80 Stunden Theorie und 120 Stunden Praxis - und trotzdem ist das Risiko hoch.“
Die häufigsten Fehler? Unzureichende Abdichtung der Anschlüsse (42 % der Mängel), zu dünne Dämmung (28 %) und schlechte Vorbereitung des Untergrunds (21 %). Ein 8 cm starker Dämmstoff bringt nur 15 % Energieeinsparung - nicht 30 %. Die Verbraucherzentrale warnt: „Dämmung unter 14 cm ist oft eine Geldverschwendung.“
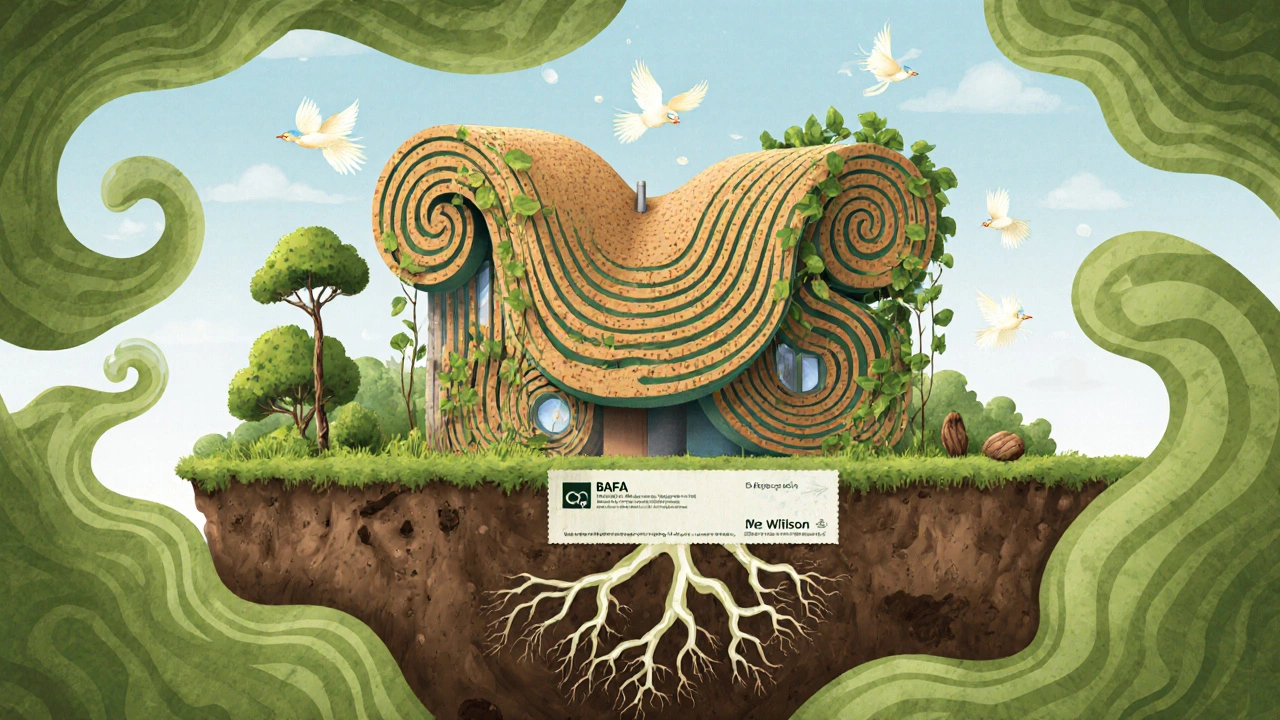
Was solltest du wählen?
Es gibt keine „beste“ Lösung. Es gibt die richtige Lösung für dein Haus.
- Neubau mit dichten Wänden? EPS ist okay - wenn du auf die Dicke achtest (mindestens 14 cm) und die Verarbeitung professionell ist.
- Altbau aus Ziegel oder Lehm? Mineralwolle oder Holzfaser. Punkt. Keine Kompromisse bei Feuchtigkeit.
- Denkmalgeschütztes Haus mit Platzknappheit? PUR oder PIR - aber nur mit einem Experten, der weiß, wie man es richtig verarbeitet.
- Umweltbewusst und langfristig denkend? Holzfaser oder Kork. Sie sind teurer, aber sie schützen deine Gesundheit, deine Wand und die Zukunft.
Und vergiss nicht: Förderung gibt es für alle. Mit dem BAFA-Programm bekommst du bis zu 25 % der Kosten zurück - egal welches Material du wählst. Die Zuschüsse laufen bis 2027. Nutze sie.
Was passiert, wenn du nichts tust?
Ab 2024 werden die Anforderungen des GEG weiter verschärft. Wer nicht sanieren kann, wird in Zukunft höhere Energiekosten zahlen - und seine Immobilie schwerer verkaufen. Die Energieausweise werden strenger bewertet. Ein Haus ohne Fassadendämmung wird in 5 Jahren als „energetisch veraltet“ gelten.
Die Marktforschung sagt: Der Markt für Fassadendämmung wächst jährlich um 11,8 %. Bis 2025 soll er um weitere 15-20 % steigen. Wer jetzt sanieren lässt, spart nicht nur Energie - er sichert den Wert seiner Immobilie.
Welches Dämmmaterial ist am besten für Altbauten?
Für Altbauten aus Ziegel, Lehm oder Stein ist Mineralwolle oder Holzfaser die beste Wahl. Beide sind diffusionsoffen, das heißt, sie lassen Feuchtigkeit aus der Wand nach außen entweichen. Das verhindert Tauwasser, Schimmel und Wandbeschädigungen. EPS oder PUR sind diffusionssperrend und können bei alten Wänden zu schwerwiegenden Schäden führen.
Wie dick muss die Fassadendämmung sein?
Mindestens 14 cm. Eine 8 cm dicke Dämmung bringt nur etwa 15 % Energieeinsparung. Bei 14-16 cm liegt die Einsparung bei 20-30 %. Das ist der Unterschied zwischen einer sinnvollen Sanierung und einer Geldverschwendung. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fordert für Neubauten und Sanierungen mindestens einen U-Wert von 0,24 W/(m²·K), der nur mit ausreichender Dicke erreicht wird.
Kann ich Fassadendämmung selbst machen?
Technisch möglich - aber nicht empfehlenswert. Die Verarbeitung erfordert Fachwissen: Abdichtung der Anschlüsse, korrekte Verklebung, Verarbeitung von Dämmplatten, Putzauftrag. Die Handwerkskammer Berlin warnt: 42 % aller Mängel entstehen durch schlechte Anschlussabdichtung. Ein Fehler kostet später Tausende Euro. Lass es von einem zertifizierten Fachbetrieb machen - besonders wenn du Fördermittel beantragen willst.
Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
Beide sind Polystyrol, aber XPS (extrudiertes Polystyrol) ist dichter, wasserunempfindlicher und hat eine leicht bessere Wärmeleitfähigkeit (0,029-0,035 W/(m·K)). Es wird oft für Boden- oder Flachdämmungen verwendet. Für Fassaden ist es überflüssig teuer - EPS ist ausreichend, wenn die Dicke stimmt. XPS ist nicht diffusionsoffen und eignet sich daher nicht für Altbauten.
Gibt es Förderung für Fassadendämmung?
Ja. Das BAFA-Förderprogramm „Altersgerecht Sanieren“ zahlt seit Januar 2024 bis zu 25 % der Kosten - maximal 15.000 Euro pro Wohnung. Das gilt für alle Materialien: EPS, Mineralwolle, Holzfaser oder PUR. Du musst einen Energieberater beauftragen und die Sanierung von einem zertifizierten Handwerker durchführen lassen. Die Förderung ist bis 2027 verfügbar.
Was kommt als Nächstes?
Die Technik entwickelt sich weiter. Forscher an der TU München arbeiten an Dämmstoffen aus Hanf und Stroh - mit Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) und CO₂-Speicherung. Sie sind noch in der Testphase, aber sie zeigen: Die Zukunft ist nicht mehr aus Erdöl, sondern aus der Natur.
Und du? Du kannst jetzt entscheiden: Einen billigen, kurzfristigen Lösung - oder eine, die dein Haus für die nächsten 50 Jahre schützt. Die Wahl ist deine. Aber die Konsequenzen bleiben - in deinen Heizkosten, in deiner Gesundheit und im Wert deiner Immobilie.